Das Hildebrandhaus in München-Bogenhausen galt einst als abbruchreif. Heute ist es ein bedeutendes Baudenkmal und Sitz der Monacensia. Der Architekt Lorenz Wallnöfer war als junger Student an der Renovierung in den 1970er-Jahren beteiligt, bei der späteren Generalsanierung von 2013 bis 2016 verantwortete er die Entwurfs- und Ausführungsplanung. Im Gespräch mit Sylvia Schütz, Kuratorin der Dauerausstellung «Maria Theresia 23», spricht er über die denkmalgerechte Sanierung, die Revitalisierung der Künstlervilla und ihre besondere Architekturgeschichte.
Ein Haus mit Geschichte – Architekt Lorenz Wallnöfer über das Hildebrandhaus
Als Lorenz Wallnöfer das Hildebrandhaus zum ersten Mal betrat, war es nicht mehr als eine verlassene Villa mit schwer beschädigter Substanz – und doch beeindruckte ihn das Gebäude nachhaltig. Jahrzehnte später sollte er mit der Sanierung eben jenes Hauses beauftragt werden. In einem persönlichen Gespräch blickt der Architekt zurück auf erste Aufmaßarbeiten als Werkstudent, die Rettung der Villa vor dem Abriss und die behutsame Wiederbelebung eines außergewöhnlichen Ortes.
Lieber Herr Wallnöfer, wie begann Ihre Verbindung zum Hildebrandhaus?
Die besondere Beziehung zum Hildebrandhaus entstand 1975 durch die Aufgabe, das Haus in seinem Bestand aufzumessen und entsprechende Pläne des Bestands zu zeichnen. Dies konnte ich in den ersten Semestern meines Architekturstudiums als Werkstudent bei Prof. Burmeister erledigen. Das Gebäude in seinem verwahrlosten, aber trotzdem großartigen Erscheinungsbild machte auf mich und meinen Kollegen einen unvergesslichen Eindruck. Je weiter die Begehung und das Vermessen der Räumlichkeiten fortschritt, desto begeisterter waren wir über die Grundrisslösungen und die vertikale Anordnung der hohen Atelierräume im Gesamtgefüge der Etagen.

Erinnern Sie sich an Ihre erste Besichtigung?
Wie gesagt, das war 1975, wir wurden von Prof. Burmeister durch das Haus geführt, der erläuterte meinem Studienkollegen Herrn Woltmann und mir die Aufgabenstellung. Eine kurze Einführung zur Person des Bildhauers Adolf von Hildebrand und zu seiner Villa erfolgte vor Ort, im Büro erhielten wir Literatur hierzu. Das Interesse an der Planung und Entstehung des Hauses war sofort geweckt.
Wie haben Sie das Haus vorgefunden? Die Substanz wurde ja mutwillig vernachlässigt und hat unter Vandalismus gelitten. Hat das Hildebrandhaus in Anbetracht seines Zustandes noch intakt gewirkt?
Das gesamte Haus war außen und innen in einem äußerst desolaten Zustand. Es war für mich damals unverständlich, wie ein Objekt dieser Qualität so vernachlässigt und beschädigt werden konnte. Die exponierte Lage in der Maria-Theresia-Straße und die erkennbare Villenstruktur der Umgebung waren für jeden Laien erkennbar. Inwieweit die Zerstörung mutwillig oder auch nach Auftrag herbeigeführt wurde, konnten wir vor Ort nicht feststellen. Es war aber naheliegend, dass der Vandalismus das Vorhaben der Beseitigung des Gebäudes unterstützen sollte. Ein Antrag auf Abbruch lag ja vor und konnte sozusagen in letzter Minute verhindert werden.
Stadtbild im Wandel
Wie war die städtebauliche Situation rund um das Hildebrandhaus?
Es gab schon Neubauten direkt neben dem Hildebrandhaus, östlich ein Bürogebäude und nördlich an der Siebertstraße einen neuen Geschosswohnungsbau. Einige Villen waren bereits renoviert, die Mehrzahl aber war noch im ursprünglichen Zustand. Eine übermäßige Verdichtung und Veränderung fand infolge nur eingeschränkt statt.
Haben Sie den Kampf um den Erhalt des Hauses miterlebt?
Die Auseinandersetzungen um das Haus, die durch ein Vorkaufsrecht beziehungsweise Enteignungsverfahren durch die Stadt München geführt wurden, habe ich erst erfahren, nachdem das Haus im Besitz der Landeshauptstadt war. Erst danach begann die Bearbeitungsphase durch das Architekturbüro mit dem Aufmaß und dem Zeichnen der Bestandspläne.

Konzept und Biografie des Hildebrandhauses
Der Bildhauer Adolf von Hildebrand hat die Villa selbst entworfen – als organische Einheit von Räumen für die künstlerische Arbeit, das Familienleben und für die Geselligkeit. Ausgeführt wurde der Bau vom Büro des damaligen Stararchitekten Gabriel von Seidl. Wie beurteilen Sie sein architektonisches Konzept?
Das Konzept von Hildebrand für sein Domizil in München realisierte Gabriel von Seidl durch einen komplexen Bau, der alle notwendigen Funktionen der beruflichen, öffentlichen und privaten Person ermöglichen sollte. Am nicht zu repräsentativen Eingang konnte der Hausherr die Gäste vom erhöhten Podest empfangen und sie direkt in den geschäftlichen Bereich der Ateliers oder ins Hochparterre in den privaten Bereich geleiten. Das große Atelier war eigens über eine Zuwegung an der östlichen Grundstücksgrenze für den Steintransport erschlossen.

Der halböffentliche und private Bereich wurde im Hochparterre geplant. Hier finden sich die Wohnräume und Salons für die Einladungen zu Gesprächen, Musik und Gesellschaft. Die privaten Räume und die Ateliers für die Töchter wurden im ersten Obergeschoss vorgesehen. Inwieweit von Seidl in die Planung eingegriffen hat, ist meines Wissens nicht erforscht. Die Ausführung der Details wie Fenster, Türen, Bodenbeläge und Deckengestaltung ist sehr solide, handwerklich aufwendig und individuell. Als Beispiel sei die ovale, ins Obergeschoss führende Treppe im dominierenden Treppenturm genannt. Interessant ist auch die Wegeführung vom Hauseingang über den gerundeten Gang zu dieser Treppe. Der Einstieg wird nochmals über einen großen Empfangsraum inszeniert. Für die Besucher war dies ein spannender und vielleicht auch überraschender Moment, nach der «Enge» in diesen großzügigen Vorraum zu den Salons zu gelangen. Ich finde diese Lösung großartig.
Bei der Konzeption der Dauerausstellung hat mich die Frage geleitet, ob ein Haus eine Biografie haben kann. Kann ein Haus Ihrer Meinung nach einen eigenen Charakter besitzen?
Häuser, in denen bedeutende oder sonst bekannte Personen gelebt und gewirkt haben und deren Bewohner*innen dieses auch noch selbst entworfen und realisiert haben, ergeben sicher biografische Wirkung. Dies ergibt nach Aufgabe der Wohnnutzung oft eine museale Nutzung, die Leben und Werk erläutern. Im Hildebrandhaus haben verschiedene Generationen und Menschen im Laufe der Zeit gelebt, sodass eine Ausstellung über die gesamte Geschichte, die sich im Haus abgespielt hat, wichtig zu erhalten und zu dokumentieren ist.
Einem Gebäude einen Charakter zuzuschreiben, scheint mir ein schwieriges Unterfangen. Man kann sicher verschiedene Eigenschaften eines Hauses – oder besser gesagt, eines Anwesens, also Haus und Garten – feststellen. Dies gilt sowohl für die äußere Erscheinung in dessen Umgebung als auch für die spezielle Wirkung der architektonischen Ausführung und die innere Gestaltung der Wegeführung und Räumlichkeiten.

Vom Abrissantrag zur Künstlervilla mit Denkmalstatus
Um den Erhalt des Hildebrandhauses wurde hart gestritten. 1969 stellte die damalige Eigentümerin, die Raulino AG, bei der Lokalbaukommission ein Antrag auf Abriss. Dass die Villa schützenswert sei, bestritt sie mit den Worten: «Diesen Landhausstil im Trachtenlook findet man in Oberbayern reihenweise. Wenn nicht Hildebrand in dem Haus gewohnt hätte, würde kein Hahn danach krähen.»1 Wie sehen Sie die Bedeutung des Hauses heute?
Das Hildebrandhaus gehört heute zu den wichtigen Künstlervillen der Stadt München und wird als solche weiterhin als gebautes Beispiel dieses Bautyps fungieren. Das Haus als «im Trachtenlook» zu bezeichnen, ist wohl eher ein journalistischer Ausrutscher. Auch über die Villa Stuck wurde schon despektierlich geschrieben, der Jugendstil fand nicht überall Beifall. Die herausragenden Bauten von Künstlerpersönlichkeiten finden aber in allen Städten der Welt Beachtung und werden als Zeugnis der jeweiligen Baukultur gesehen.
Warum war die erste Anwendung des modernen Bayerischen Denkmalschutzgesetztes auf das Hildebrandhaus so wichtig?
Die Anwendung des «Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerische Denkmalschutzgesetz – BayDSchG)» von 1973 konnte das Haus vor dem Abbruch schützen und damit ein Zeugnis der Baukultur und das Andenken an seine Erbauer erhalten. Durch die Nutzung als öffentliche Bibliothek, als Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude entsteht eine Beziehung nach außen im Stadtbild: eine historische Villa im Garten. Zugleich ist durch die allgemeine Zugänglichkeit eine Erinnerungskultur an die vormaligen Bewohner*innen und an die heutigen Angebote in den Räumlichkeiten gegeben.
Von 1974 bis 1977 wurde das Hildebrandhaus nach Plänen des Architekten Enno Burmeister umgebaut und renoviert. Er sprach bei der ersten Sanierung von «Revitalisierung». Das klingt nach einer Wiederbelebung, nach Erweckung aus einem «Dornröschenschlaf» – war es ein wenig so?
«Revitalisierung» ist ein Begriff aus der praktischen Denkmalpflege wie «Restaurierung» oder «Instandsetzung». Gemeint ist mit Revitalisierung eben nicht nur eine bautechnische und baukünstlerische Bearbeitung der Bausubstanz zu deren Erhalt, sondern auch das Finden einer adäquaten Nutzung für das Haus. Immer wieder ist eine neue Nutzung für ein Objekt «lebensrettend», da die ursprüngliche Nutzung nicht mehr angesagt ist. Nach langem Leerstand und Verfall war der Einzug der Monacensia eine Wiederbelebung mit neuer Nutzung.

2011 beauftragte Sie der Münchner Stadtrat mit der Sanierung und Neukonzeption des Hildebrandhauses. Wie sind Sie das Projekt angegangen? Welche Ideen lagen Ihrer Planung zugrunde – und welche Herausforderungen galt es zu bewältigen?
Die Neukonzeption des Hauses basierte in erster Linie auf den Vorstellungen der damaligen Leitung der Monacensia Frau Dr. Tworek. Aus ihren langen Erfahrungen mit dem Haus und ihrem Team wurden die verschiedenen Bereiche, die einer zu ändernden Gestaltung anstanden, ausführlich mit den Vertretern des Baureferates der LH München diskutiert. Aus diesen Wünschen und Anregungen entwickelte mein Büro einen durchführbaren, genehmigungsfähigen Entwurf, der Denkmalschutz und Umgestaltung einzelner Räume und auch den neuen Anbau in Einklang brachte. Zentrales Thema war die Wiederherstellung und Öffnung des großen Tores im ehemaligen Atelier, barrierefreie Rundgänge für die künftigen Ausstellungbereiche im Erdgeschoss und die Anbindung der Bibliotheksräume im Obergeschoss.
Als verbindendes Element für die notwendigen Nebenräume im Untergeschoss mit den Ausstellungs- und Bibliotheksräumen wurde ein Aufzug geplant. Für die Mitarbeitenden erleichtert dieser im Arbeitsalltag auch den Transport von Materialien. Die Herausforderung bei der Planung bestand im Umsetzen der Ideen unter den Bedingungen des Denkmalschutzes, der Sicherheitsanforderungen in Bezug auf die originalen Autografen, der Bedürfnisse der Stadtbibliothek und damit zusammenhängend einer Haustechnik auf neuestem Stand.

Bei der Sanierung wurde das Gebäude so weit wie möglich in seinen ursprünglichen historischen Zustand zurückversetzt und gleichzeitig auf den neuesten technischen Stand gebracht. Es gab auch eine behutsame Erweiterung: einen Glasanbau an der Atelierseite. Welche Idee war mit dieser baulichen Veränderung verbunden?
Es waren verschiedene Gesichtspunkte zu betrachten: Zum einen sollte durch das Wiederöffnen des großen Tors an der Südseite des Ateliers ein Windfang geschaffen werden, der das Öffnen auch zur kalten Jahreszeit sinnvoll ermöglicht. Zum anderen sollte ein barrierefreier Eingang angeboten werden, der nicht durch die «Hintertür» als Nebeneingang fungiert. So ergaben sich die Dimensionen des Anbaus auch noch durch das Einhalten der notwendigen Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken. Da das Tor nach außen aufgeht, war die Höhe festgelegt, die Außenkante zum Garten bestimmt die Abstandsfläche. Der Anbau wurde als großer Torriegel geplant, der durch ein Glaselement an den Bestand andockt und die Fassade respektiert. Durch die großflächige Verglasung zur Freifläche sollte die Verbindung zum Garten geschaffen werden. Dieser wurde übrigens von dem Gartenarchitekten Christoph Sattler in italienischer Manier gestaltet – einem Urenkel Adolf von Hildebrands.

Vielen Dank für das spannende Interview und die interessanten Einblicke – Sie haben unser Verständnis für das Thema deutlich vertieft!
Heute ist das Hildebrandhaus nicht nur Denkmal, sondern ein lebendiger Ort für Literatur, Forschung und Austausch – auch dank Architekt Lorenz Wallnöfer, der mit viel Gespür für Geschichte und Zukunft eine Vision für das Haus entwickelt hat.
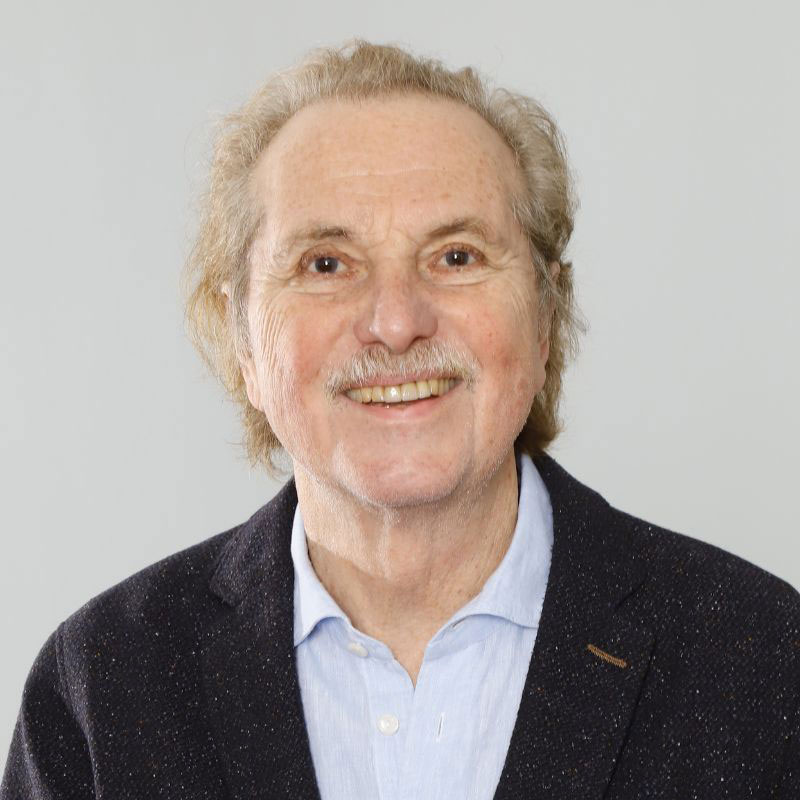
Lesetipps zum Hildebrandhaus:
- Julian Nida-Rümelin: Eine Jugend im Hildebrandhaus – (20.10.2024)
- Patrick Geiger: Elisabeth Braun und die Monacensia – Ein Vermächtnis in Spuren – (27.01.2024)
- Das Hildebrandhaus: Eine Münchner Künstlervilla und ihre Bewohner in der Zeit des Nationalsozialismus, 2006.
- Christine Hoh-Slodzek, Enno Burmeister, Das Hildebrandhaus. Sein Erbauer – Seine Bewohner, München 1983
- Münchner Merkur, 6.2.1970, S. 16. ↩︎
Führungen durch unsere Ausstellungen:
Anmeldung jeweils über die MVHS
Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa
(Ausstellung «Maria Theresia 23»):
Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.
Anmeldung über die MVHS
Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann
(wird im Januar 2026 abgebaut):
Samstags um 15 Uhr: 27.12.
Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26




3 Antworten
Sehr sehr schön gerettet!!!
Komme bald!
Liebe Brigitte Wiegerling,
das freut uns sehr. Wir haben jetzt auch wieder ein Café, das Café Lev, das Dienstags bis Samstags von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet hat. Unsere Ausstellungen sind geöffnet: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 9.30–17.30 Uhr, Donnerstag von 12–19 Uhr und Samstag, Sonntag von 11–18 Uhr. Wir haben jetzt auch ein neues Dossier „Das Hildebrandhaus“ zur Dauerausstellung sowie eines zum „Literarischen München zur Zeit von Thomas Mann„, die alle Artikel zum Thema aufführen und eine gute Einstimmung oder Nachlese bieten, da sie permanent um neue Artikel ergänzt werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen ganz viel Inspiration!
Herbstliche Grüße
Tanja Praske, Monacensia