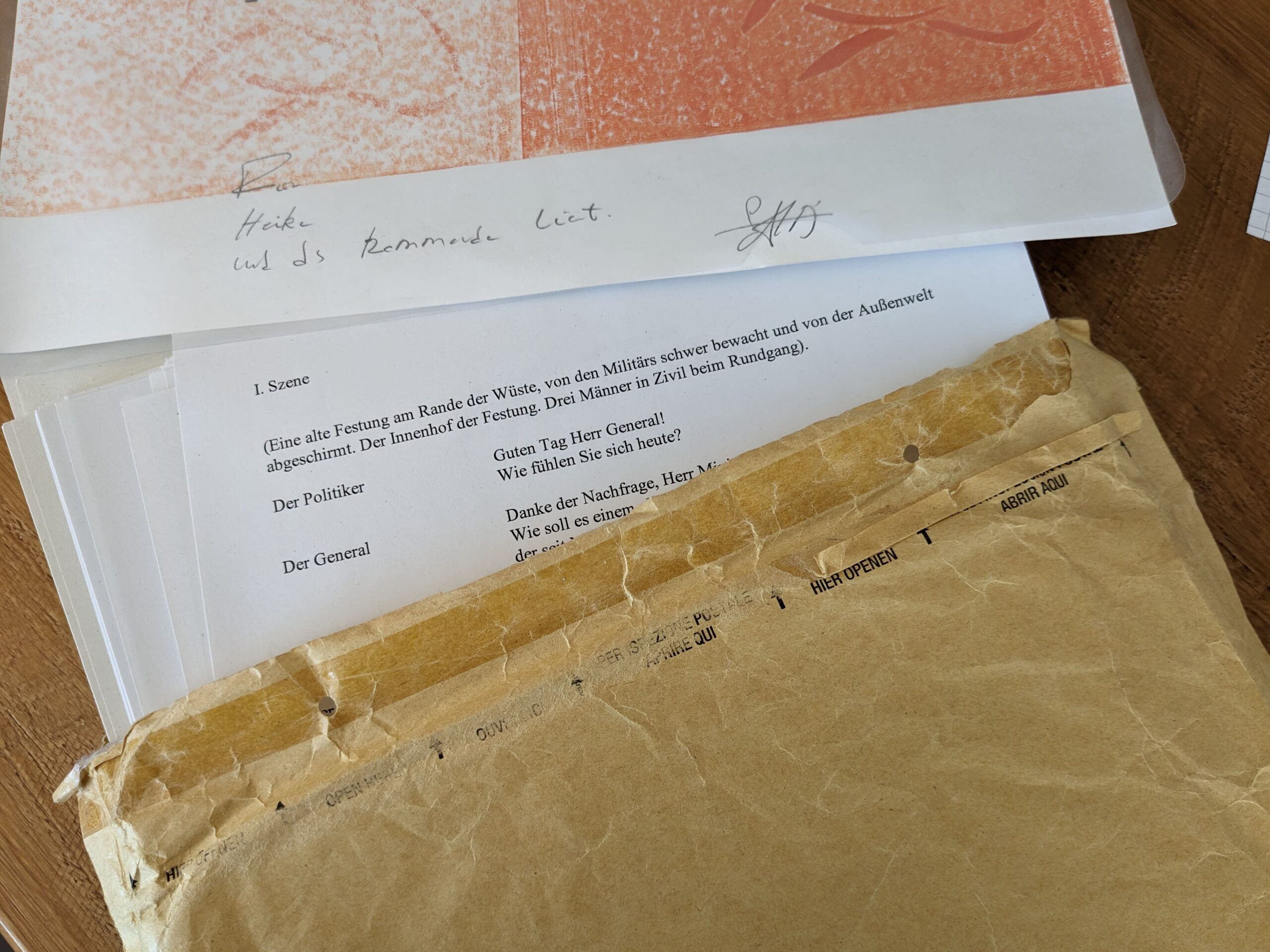Die in Italien lebende Autorin Helena Janeczek schildert in ihrem Essay einfühlsam von ihren Besuchen des Neuen Israelitischen Friedhofs. Ihre Eltern, polnisch-jüdische Holocaust-Überlebende, liegen hier begraben. Eine berührende Gedankenwelt tut sich uns auf mit: Ironie des Schicksals, Zivilisationsbruch, rot-weißen Plastikbändern, Alleingelassenwerden und Erneuerungen jüdischen Lebens.*
Helena Janeczek über den Neuen Israelitischen Friedhof in München
Seit Anfang der Pandemie war ich nicht mehr in München. Im März 2020 platzte eine Veranstaltung bei euch, der Monacensia, weil ich im Hochrisikogebiet Lombardei lebe; im Oktober, als sich die zweite Welle in ganz Europa verbreitete, auch der verschobene Termin.
Wann war ich das letzte Mal in der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin? Das weiß ich nicht einmal genau, muss es erst anhand von E-Mails, Buchungen, Fotos rekonstruieren.
In Dezember 2019, bald sind es zwei Jahre her.
So lange war ich nicht mehr bei meinen Eltern auf dem jüdischen Friedhof an der Domagkstraße.
Mir ist bewusst, dass viele nichts mit Friedhofsbesuchen anfangen können, auch wenn die dort bestatteten Menschen ihnen lieb und wichtig bleiben. Ich aber war immer glücklich – ja, glücklich! –, wenn ich, ab und zu wieder in München, meinen Vater besuchen konnte. Er starb, als ich zwanzig war und schon in Italien lebte.
Vor neun Jahren musste ich mich auch um das Grab meiner Mutter kümmern, die sich keinen Platz neben ihrem Gatten gesichert hatte.
Nach jüdischem Brauch gibt es Paargräber; Doppelgräber sind nicht erlaubt, da jeder Bestattete am Ende der Zeit, wenn der Messias gekommen ist, wieder auferstehen soll, ohne dass sich auch nur ein Knöchelchen in ein falsches Gebein verirrt.
Aber das, was heute die Orthodoxie bestimmt, war nicht immer feste Regel. Auch nicht auf dem Neuen Israelitischen Friedhof – so der offizielle Name –, der 1908 eröffnet wurde. Das waren die letzten Jahre der Belle Époque, einer Zeit, in der das Bürgertum an Fortschritt und Frieden glaubte und im sozialen Aufstieg weiterkam: auch in der jüdischen Gemeinde Münchens.
Man hatte Orgeln in der Synagoge, druckte elegante Einladungen und Anzeigen, auf denen die Bar Mitzvah „Konfirmation” genannt wurde, und stellte immer öfter, unweit der Menorah, einen stattlichen Christbaum auf.
Das alles wusste ich mehr aus Büchern als über direkte Erzählungen, denn während meiner Schulzeit in den 1970er und frühen 1980er Jahren bestand die Münchner jüdische Gemeinde größtenteils aus Menschen wie meinen Eltern: Überlebende der Shoah, die nach dem Krieg aus Osteuropa westwärts geflohen und, nach Internierung in einem bayrischen DP-Camp der Amerikaner, in der Landeshauptstadt hängen geblieben waren.
Auf dem Friedhof, der mir erst vertraut wurde, als auch mein Vater dort lag, ist das nachzulesen.
Die Grabinschriften geben Geburtsorte in Polen, Ungarn, Rumänien an, wobei sich die Namen dieser einst stark jüdisch geprägten Orte – wie auch deren Landeszugehörigkeit – manchmal geändert hatten. Lag die Herkunft der Verstorbenen zum Beispiel in Schlesien, Galizien oder Siebenbürgen, steht oft der vor der Nazizeit geltende Ortsname neben dem heutigen oder nur der alte deutsche Name. Alle Inschriften sind auf Deutsch und Hebräisch, denn der obere Teil der Matzewa, des Grabsteins, benennt und segnet die Toten in der Sprache und nach Brauch und Kalender der jüdischen Religion.
Was aber vermutlich und sinngemäß nur auf Deutsch eingemeißelt ist, sind Sätze zur Erinnerung an die in der Shoah ermordeten Familienmitglieder. Ich schreibe „vermutlich”, denn leider bin ich des Hebräischen nicht mächtig, und „sinngemäß”, weil dieses Gedenken nichts herkömmlich Rituelles besitzt. „Sinngemäß” aber vor allem, weil die Inschriften dem Bedürfnis entsprangen, den Vernichteten ein Denkmal zu setzen, als Ersatz für ein Grab nicht in den Lüften, als symbolische Reparation der individuellen Zugehörigkeit und Würde, wie sie ein Name bezeichnet. Vielleicht auch um etwas zu begradigen an der Ironie des Schicksals – oder des Zufalls –, dass Überlebende der deutschen Erderoberung wieder in deutscher Erde bestattet wurden, sollte gerade dort das Andenken an die in Osteuropa Ermordeten unauslöschlich bewahrt werden, allen verständlich, die auf den Friedhof kamen.
Den Satz zur Erinnerung an die Familie meines Vaters habe ich verfasst, damals, vor sechsunddreißig Jahren, ohne viel mehr zu wissen, als dass sämtliche Namen der toten Eltern und Geschwister keinen Platz auf seinem Grabstein gefunden hätten. Diese Vornamen stehen auf anderen Gräbern, aber überall zusammen mit Worten wie „deportiert” „umgekommen” „ermordet”: in Auschwitz oder einem anderen Lager beziehungsweise Ort der Vernichtung. Der Begriff „Holocaust” tritt hinzu, „Shoah” vielleicht in neueren Teilen des Friedhofs, die ich lange nicht wahrgenommen habe, so lange, bis es nötig war, für meine Mutter einen Grabplatz zu finden.

Jedenfalls habe ich mich manchmal gefragt, ob die auf Deutsch verfassten Inschriften, auch die zum Gedenken an den verstorbenen Menschen, direkt so formuliert oder irgendwie übersetzt worden waren. Denn in den Familien derer, die es nach dem Krieg nach München verschlagen hatte, wurde zu Hause polnisch, ungarisch, rumänisch und vor allem jiddisch weiterbenutzt. Aber das Mameloshn, wenn auch eine Generation lang weitergepflegt als heimische (und zum Teil auch heimliche) Muttersprache, passte nicht auf die Grabsteine. Hebräisch war seit jeher die Sprache, die einem jüdischen Leben Sinn und Segen verlieh.
Dazu kam, dass über den Wert der Granit- oder Marmorsteine, über die Form und Größe und die oft goldene Beschriftung vermittelt werden konnte, dass die Verstorbenen, obwohl sie wörtlich von nichts anfangen mussten, es zu etwas gebracht hatten in Deutschland. Jeder Friedhofsbesucher sollte verstehen, dass das Leben des geliebten Menschen – einer Mutter und Gattin, zum Beispiel – „Güte und Treue”, das Schaffen eines Vorstands der Gemeinde „vielverdient” und „hochgeachtet” war, auch wenn diese Worte, Sätze bieder deutsch klingen.
Wie sehr ähneln diese Inschriften denen aus der Vorkriegszeit! Als wäre das jüdische Leben in München nicht völlig zerstört worden, die deutschen Juden ermordet oder vertrieben in andere Länder und Kontinente, aus denen sie nur selten zurückkamen. Als hätte es nicht gegeben, was der Begriff „Zivilisationsbruch” bezeichnet.
Seit ich anfing, meinen Vater zu besuchen, war dieser Zivilisationsbruch sichtbar als rot-weißes Plastikband, das den Zutritt zu dem ältesten, vorderen Teils des Friedhofs verhinderte. Das blieb so über Jahrzehnte, in denen ich im Vorübergehen auf die monumentalen Familiengräber lugte, ihre klassizistische oder Jugendstil-Architektur bewundernd, auf denen Inschriften auf Hebräisch und jüdische Symbole eher selten waren. Ich saugte mit den Augen auf, was sich mir bot: verschwundene Titel wie der des Kommerzienrats, Namen einst großer Bürgerfamilien – die Bernheimer, die Rosenthals –, Namen, die auf den Herkunftsort zurückwiesen – Mannheimer, Landauer, Steinharter – und viele, viele deutsche Vornamen: Heinrich, Grete, Max, Lotte, Adolf …
Es muss sehr schwierig sein, einen jüdischen Friedhof zu sanieren, da die verfallenden, in die Erde versackenden Steine nicht verrückt, restauriert und schon gar nicht aufgelassen werden dürfen. Aber irgendwann war das Plastikband beseitigt, und ich konnte den bislang versperrten Teil erkunden. Da gibt es eine Reihe, in der die Gefallenen des Ersten Weltkriegs beerdigt sind; mit Verdienstkreuzen gekürt, für den Opfertod gerühmt, liegen diese Heldengräber ganz nah am Gehweg.
Eines, das mich so sehr beeindruckte, dass es mir den Einstieg für ein Gedicht erlaubte (ich schreibe selten Gedichte, nur noch auf Italienisch und kann sie nicht selbst übertragen), ist ein roh belassener alpiner Steinblock. Darunter ruhen die Überreste des achtzehnjährig für Kaiser und Vaterland 1919 in Frankreich Gefallenen Siegfried Oppenheimer und seines bei einer Bergtour verschollenen Bruders Werner. Was ist wohl mit den Eltern passiert während der Nazizeit? Das läßt der für zwei verlorene Söhne errichtete Grabstein nicht erahnen. Unser Paulinchen hingegen starb noch als Kind im ersten Jahr der Weimarer Hyperinflation. Ihr Grab ist klein, aus schlichtem Material, porös, seitlich eingesunken. Unweit von diesen Kindergräbern liegt ebenso unspektakulär ein Kurt Stern, der irgendwie lebend durch den Krieg kam, um 1948 mittleren Alters zu versterben. Von der in den einfachen Stein eingetragenen Schrift sind mittlerweile nur der Name und die Lebensdaten lesbar geblieben.
Der Zivilisationsbruch ändert nahe betrachtet sein Aussehen, spricht von einem schmerzlich langsamen Versinken und Verschwinden, vom Alleingelassenwerden dieser Gräber, die niemand mehr besucht. Währenddessen entstehen in der Nähe des Grabs meiner Mutter neue Teile, die eine Erneuerung des jüdischen Lebens in München bezeugen. Unter dem nun vorgeschriebenen hebräischen Kopf der Inschriften kommt ein weiteres Alphabet hinzu: kyrillisch. Die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion wollen sich auch nach dem Tod nicht vom Russischen verabschieden.
Nichts wird wieder so, wie es früher war. Aber es wird immer wieder anders.
Schaut euch zum Buch unbedingt die aufgezeichnete Live-Online-Lesung mit der Autorin auf dem YouTube-Kanal der Münchner Stadtbibliothek an:
* Das Monacensia-Dossier „Jüdische Schriftstellerinnen in München“ macht anlässlich „#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland“ Leben und Wirken jüdischer Schriftstellerinnen in München sichtbar. Es dokumentiert literarische Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart. Ein Projekt im Rahmen von #femaleheritage.
Bisher erschienen:
- „Emma Bonn – Schriftstellerin und Dichterin: Aufbereitung einer Familiengeschichte“ von Katrin Diehl (30.09.2021)
- „Lena Gorelik: „Schreib doch mal, Lena“ – ein Essay über jüdisches Leben in München“ (27.07.2021)
- „Elisabeth Braun und andere verschwundene Frauen – Suchstrategien in der Frauenforschung“ von Lilly Maier (30.06.2021)
- „Regina Ullmann – Dichterin und Erzählerin: „Die Welt in dir / zerbricht nicht mehr“ von Dr. Lisa Jeschke (21.6.2021)
- „Die Schriftstellerin Carry Brachvogel (1864-1942) und die moderne Frau in der Literatur“ von Dr. Ingvild Richardsen (16.6.2021)
- „Jüdische Kinder hatten wir noch nie“: Dana von Suffrin über eine Familie in München – ein literarischer Beitrag zu #2021JLID (23.3.2021)
- „Erzählen gegen das Vergessen: Grete Weil“ von Prof. Irmela von der Lühe (19.3.2021)