Jonas Bokelmann spricht im Interview über die Interaktion mit dem Publikum bei Lesungen, über politisches Schreiben sowie über das Rezensieren und Kuratieren von Texten. Zudem geht es um die Frage, wie Literatur Gesellschaft reflektieren kann – elfte Folge der #AtelierMonaco-Szene der Monacensia.*
Jonas Bokelmann ist Autor, Literaturvermittler und -wissenschaftler. 1984 in Duisburg geboren, ist er in München aufgewachsen. Er studierte Komparatistik, Skandinavistik und Neuere und Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und in Reykjavík und promovierte über «Islandexil und Widerstand im nachgelassenen Spätwerk Albert Daudistels«. Zusammen mit Slata Roschal kuratiert und moderiert er die Lesereihe werk[statt]. Für mehrere Magazine und Blogs schreibt er Rezensionen. Seine eigenen Texte verfasst er am liebsten in Kooperation mit anderen Kunstschaffenden und präsentiert sie auf der Bühne.
Jonas Bokelmann: Von Parks und Kreativität, Science-Fiction und Fantastik, Schallplatten und Lyrik

Wir haben uns trotz winterlicher Temperaturen im Westpark getroffen. Welche Bedeutung haben Parks für dein literarisches Schaffen?
Einerseits helfen sie mir aus den Schleifen, in denen ich mich im Alltag bewege. Das gelingt mir, wenn ich ohne ein konkretes Ziel vor Augen den Wegen folge, zufällig auf Kreuzungen stoße und unerwarteten Dingen begegne. Andererseits sind für mich Parks Inspirationsquelle und Thema. Der Philosoph und Stadtsoziologe Henri Lefebvre hat die Stadt als die Verdichtung des Unterschiedlichen bezeichnet. Ich denke, dass sein Diktum insbesondere für den Stadtpark gilt, denn hier kommen viele verschiedene Menschen zusammen und treten in einen Aushandlungsprozess. Es entsteht sowohl gesellschaftliches Leben als auch spontan Kreatives und Ästhetisches.
Bis vor ein paar Jahren hast du einige deiner Texte auf deiner Homepage veröffentlicht. Dabei handelt es sich vor allem um lyrische und kürzere Prosatexte. Sind das die Genres, in denen du dich bewegst?
Begonnen habe ich mit Kurzprosa. Ich war einerseits beeinflusst vom erzählerischen Punkrock von Bands wie «Turbostaat» sowie von den verrückten, surrealen Geschichten der Jens-Rachut-Bands «Angeschissen», «Blumen am Arsch der Hölle» und «Dackelblut». Andererseits haben mich Science-Fiction-Kurzgeschichten inspiriert. Über die Musik bin ich auch zu Texten gekommen, die mit einzelnen Wörtern spielen und die zum Beispiel mit End- oder Binnenreim arbeiten. Jetzt schreibe ich vorwiegend Lyrik und sketchähnliche Texte.
Wie die Parodie auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die du zusammen mit der Singer-Songwriterin Tamara Banez geschrieben hast?
Genau. Das war der Versuch, die Brecht’sche Form der Wiederherstellung von Wahrheit zu adaptieren. Wir haben aus dem Text eine Bühnenform entwickelt. Das hat so Spaß gemacht, dass wir anschließend einen weiteren Text für die Bühne verfasst haben. «Die Sache mit G. Annäherung an eine Festung» ist inspiriert von einem realen Fall. Er handelt von einer Person, die sich über YouTube einen Shitstorm einfängt, sich deswegen an dessen Mutterfirma Google wendet und dann herausfinden muss, dass es unmöglich ist, dieser Firma real zu begegnen.
Welche Rolle spielt der Auftritt für die Präsentation deiner Texte?
Die Bühne ist für mich das Wichtigste. Ich bin dabei inspiriert vom Situationismus als Versuch, etwas auf der Bühne zu gestalten, das auch im Publikum etwas auslöst. Ich möchte etwas schaffen, dass nicht nur inhaltlich von Demokratie redet, sondern wirklich zu einer Interaktion und einer Beteiligung des Publikums führt.

Findest du genug Auftrittsmöglichkeiten und Bühnen, wo du das praktizieren kannst?
Aus dem Stegreif fallen mir einige ein. Neben den literarischen Bühnen gibt es noch die Kollektive, die im musikalischen Bereich aktiv sind. Zwar machen die einen Bühnen gewohnheitsgemäß mehr Literatur und die anderen mehr Musik, aber ich habe den Eindruck, dass auf beiden Seiten eine prinzipielle Offenheit besteht.
Du arbeitest für deine Texte häufig mit anderen Kunstschaffenden zusammen. Was bedeuten dir diese Kooperationen?
Ich blühe nicht unbedingt kreativ auf, wenn ich allein bin. Ich führe gern Gespräche und diskutiere leidenschaftlich gern. Ich finde es gut, mit Vorstellungen und Ideen konfrontiert zu werden, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, und die mich vielleicht sogar ein bisschen herausfordern, sodass ich mich mit ihnen auseinandersetzen muss.
Du beschäftigst dich in deinen Texten immer wieder auch mit politischen Themen. Wie wichtig ist die Politik für dein Schreiben?
Ich bin ein politischer Mensch, deswegen beschäftigen mich auch beim Schreiben politische Themen. Aber es ist nicht so, dass ich mir diese Themen vornehme, um sie literarisch zu bearbeiten. Ich finde es gut, wenn mich Kunst herausfordert und überrascht. Deshalb probiere ich auch selbst beim Schreiben Dinge aus, versuche persönliche und politische Erfahrungen mit Einsichten zusammenzubringen, die gegen den Strich laufen.
Wie gehst du dabei vor?
Ich versuche, das quasi «im Vorbeigehen» zu machen. Bewundernswert finde ich Bands wie die «Liga der gewöhnlichen Gentlemen»: In ihrem Lied über den Matratzen Concord bearbeiten sie beispielsweise das Phänomen von Läden, in denen nie ein Mensch zu sehen ist, und man sich fragt, warum das so ist. Eine andere Möglichkeit ist es, wie die Bands «Fehlfarben» oder «Family 5» einfach den Alltag zu beschreiben und sich zugleich auf politische Themen einzulassen, wie sie einem spontan in den Sinn kommen. So entdeckt man möglicherweise im eigenen Alltag neue die Politik betreffende Aspekte.
Was ist dein Anliegen beim Schreiben?
Ein Aspekt ist für mich der des Sortierens. Es gibt Entwicklungen, auf die ich mit dem Schreiben einen anderen Blick werfen möchte, um dadurch einen Umgang mit ihnen zu finden. Ein zweiter Aspekt ist der Versuch eines sozialen Experiments durch Literatur, denn sie kann es schaffen, Leute zusammenzubringen. Und der dritte Aspekt ist die Idee von Literatur als Experiment. Ich meine damit, dass Literatur historische Vorgänge sortieren und Zusammenhänge darstellen, aber dabei gleichzeitig auch neue Zusammenhänge schaffen kann. Experimentcharakter hat für mich auch Science-Fiction-Literatur im besten Sinne, wenn sie gesellschaftliche Entwicklungen antizipiert und prognostisch arbeitet.
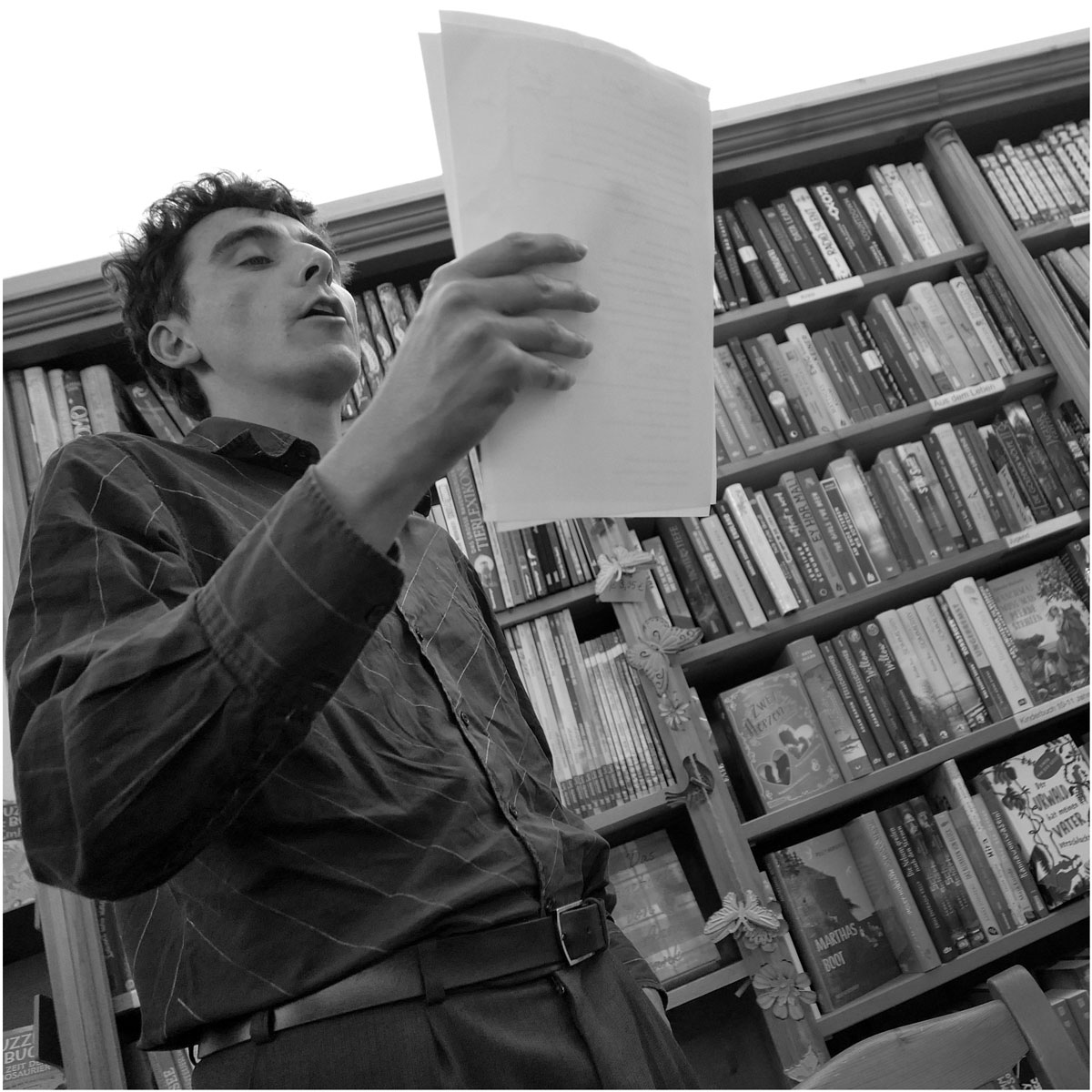
Neben deinen eigenen Auftritten bringst du andere Schreibende auf die Bühne. Gemeinsam mit Slata Roschal kuratierst und moderierst du die Lesereihe werk[statt]. Auf eurer Homepage steht, dass es euch dabei um die literarische Betrachtung von Gesellschaft und Politik geht. Das ist relativ weit gefasst.
Das ist auch so beabsichtigt. Ich fände es anmaßend zu entscheiden, wie Literatur Gesellschaft reflektieren soll. Auch weil das nicht nur über Inhalte funktioniert, sondern genauso über bestimmte Formen. Auch ein TikTok-Trend kann gesellschaftlich wichtig sein, weil er beispielsweise die Rezeptionsgewohnheiten verändert und die Art und Weise, wie Menschen Kunst produzieren.
Für eure Lesungen setzt ihr stets Schwerpunkte. Wie wählt ihr diese aus?
Wir suchen interessante und spannende Autorinnen und Autoren aus, die wir zu Duos zusammensetzen. Meistens entstehen diese organisch, weil wir darauf achten, beispielsweise unterschiedliche Alter und Geschlechter zu präsentieren. Danach überlegen wir, was die Duos verbindet, und entwickeln auf dieser Basis die Themen.
Was kann einem eine Lesereihe wie die werk[statt] geben?
Unser Anspruch ist es, ein Gespräch zu den Texten zu führen, dessen Ablauf nicht hundertprozentig vorhersehbar ist. Natürlich haben wir ein Skript. Im besten Fall ergibt sich aber etwas Neues aus dem Gespräch zwischen uns, den beiden Autor*innen und dem Publikum, sodass ein Forum-Charakter entsteht.
Zu diesem Konzept passt die Wahl der Buchhandlung Rauch & König, wo ihr die konventionelle Bühnen-Publikumssituation aufbrechen könnt.
Genau. Mir gefällt es generell, dass Lesereihen häufig in ganz verschiedenen Settings stattfinden. Wenn die üblichen Erwartungen nicht bedient werden, wird man immer wieder überrascht und muss sich ein bisschen öffnen.
Du verfasst auch Rezensionen. Wie unterscheidet sich dabei deine Herangehensweise von der Vorbereitung einer Lesung?
Bei der Lesungsvorbereitung kristallisieren sich im Gespräch mit Slata die Themen heraus, und von diesen ausgehend entwickle ich meine Fragen zu den Texten. Wenn ich eine Rezension schreibe, bleibe ich näher am Text, arbeite viel mit Belegen und Beispielen.
Neben deinem eigenen Schreiben, dem Kuratieren und Rezensieren von anderer Literatur beschäftigst du dich auch wissenschaftlich mit Literatur. Du hast erst vor Kurzem deine Promotion über den Autor Albert Daudistel abgeschlossen. Steht deine wissenschaftliche Arbeit in Wechselwirkung mit deiner literarischen Beschäftigung?
Ja, gerade wenn ich mich viel mit einer bestimmten Philosophie oder mit einem theoretischen Ansatz beschäftige, beeinflusst das meine Wahrnehmung der Umgebung und auch den Gestus meines Sprechens. In mein eigenes Schreiben ist beispielsweise sicherlich die Bloch’sche Konzeption einer Politik der Affekte eingegangen. Sie besagt, dass es für die politische Linke neben der logischen Argumentation auch wichtig ist zu überlegen, wie sie Affekte auslösen kann. Dies darf Bloch zufolge nicht den Rechten überlassen werden, weshalb dem faschistischen Mythos rote Geheimnisse entgegengesetzt werden müssen. Deshalb beschäftige ich mich auch gern mit entsprechenden Texten wie mit Formen der Fantastik oder des Märchens.
Abschließend noch einmal zurück zur Münchner Literaturszene. Du hast vorhin schon dein Anliegen anklingen lassen, dass sie sich anderen Sparten gegenüber mehr öffnet …
Total. Die Band «Der Plan» hat das mal so formuliert: «Mehr Kunst in die Musik, mehr Musik in die Kunst.» Der Aspekt der Musik ist für mich einfach sehr wichtig. Ich lese Schallplatten wie Lyrikbände, denn Literatur kann auch aus Musik heraus entstehen. Und ich finde die Idee spannend, musikalische Strukturen wie Takt und Rhythmus als neuen Impuls für meine Literatur zu nehmen.
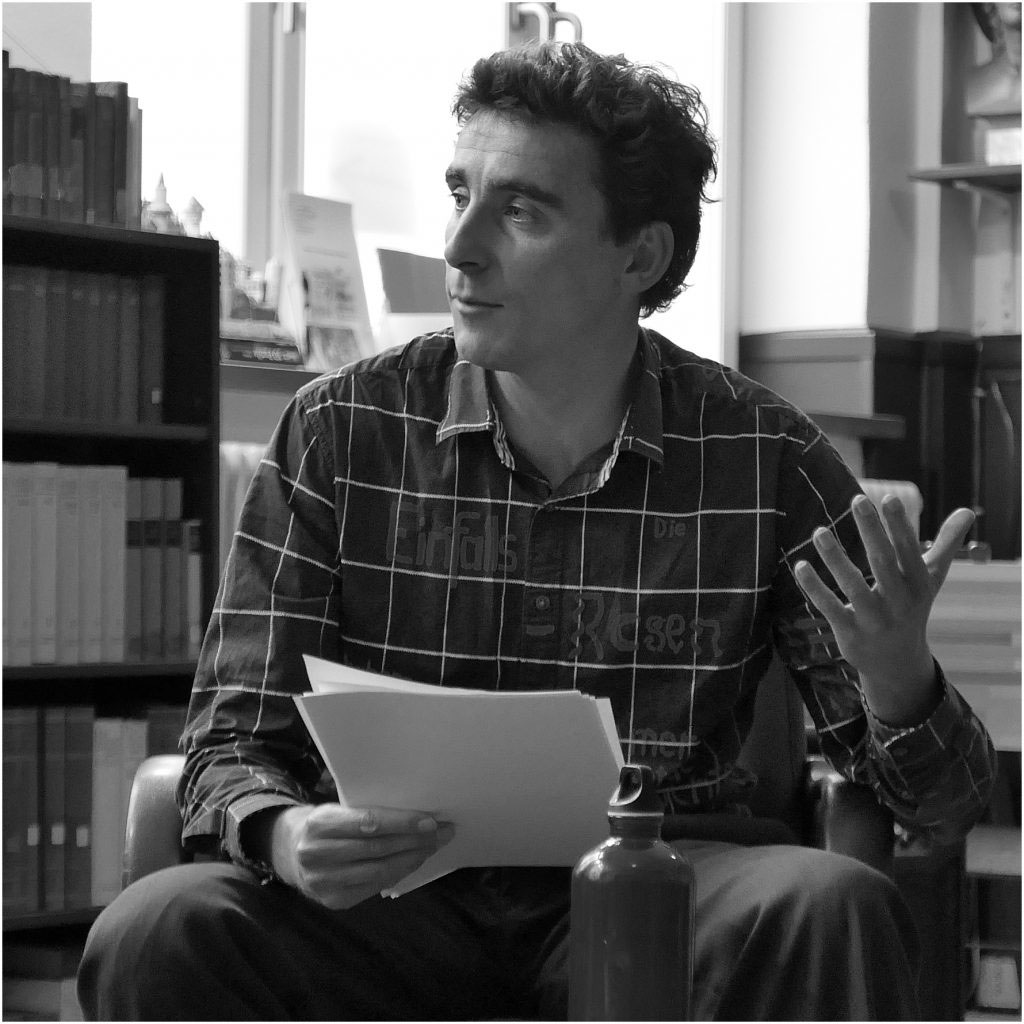
*AtelierMonaco-Szene
Die Reihe „Atelier Monaco-Szene“ erscheint alle zwei Monate im Blog der Münchner Stadtbibliothek. In der ersten Staffel sprechen Katrin Diehl (1-6), in der zweiten Christina Madenach (ab Folge 7) mit Autor*innen über ihre literarischen Tätigkeiten, Netzwerke, eigene Verlage und literarische Lesereihen in München – es entsteht eine Kartografie der Atelier Monaco Szene in der Stadt.
- Autor und Schauspieler Delschad Numan Khorschid über das Schreiben auf Deutsch und Kurdisch, seine Arbeit am Residenztheater und die Münchner Kunst- und Literaturszene (19.11.2025) – 14
- Lyrikerin Karin Fellner über das Schreiben von Gedichten, Sprachspiel und Münchens Lyrikszene (17.9.2025) – 13
- Pierre Jarawan über Schreiben als Handwerk, den Libanon und die Kunst des Geschichtenerzählens (25.6.2025) – 12
- Jonas Bokelmann: Über Bühnen, den Einfluss von Musik auf Literatur und die Lesereihe werk[statt] (16.4.2025) – 11
- Dominik Wendland: Über Comic-Tagebücher, die ArtZi-Werkstatt und die Comicszene in München und Bayern (19.2.2025) – 10
- Malva Scherer: Über Songtexte, Musikvideos, Fotos und die Münchner Musik- und Literaturszene (4.12.2024) – 9
- Daniel Graziadei: Über Lyrik und Performance, Schreibwerkstätten und die Münchner Literaturszene (8.10.2024) – 8
- Fabienne Imlinger: Über subversive Prozesse, Empowerment und eine freie Literaturszene in München (26.6.2024) – 7
- Theresa Seraphin: Experimentelles Schreiben und das richtige Maß an Ablenkung (25.4.2024) – 6
- Lisa Jeschke über Lyrik, Performance und politisches Schreiben (7.2.2024) – 5
- Jan Geiger über erste Schreibversuche, Schreiben als Beruf und Theatertexte (1.12.2023) – 4
- Annegret Liepold über die «Bayerische Akademie des Schreibens», Schreibprozesse und «Franka» (26.10.2023) – 3
- Christina Madenach über Schreibroutinen, Romanwerkstatt und die freie Literaturszene Münchens (9.8.2023) – 2
- Tristan Marquardt über Lyrik, literarische Netzwerke und Lesereihen in München (14.6.2023) – 1



