Thomas Mann lebte mit einer Angst, die viele Männer seiner Zeit teilten: erwischt zu werden. Denn der Paragraph 175 stellte gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe. Was als juristische Norm im Kaiserreich begann, wurde unter dem NS-Regime zur tödlichen Verfolgung – und blieb in der Bundesrepublik jahrzehntelang weiter bestehen. Diese Geschichte erzählt, wie tief ein Gesetz in Literatur, Gesellschaft und persönliche Schicksale eingriff – und warum sein Schatten bis heute nachwirkt.
Thomas Manns Angst – und ein Gesetz, das Liebe verbot
Im Januar 1897 lebt Thomas Mann für einige Monate in Rom, nahe des Pantheons. Mit der Heimat hält er per Brief Kontakt, schreibt oft an seinen Lübecker Schulfreund Otto Grautoff. Denn die beiden verbindet ein Geheimnis, das sie quält: ihre Liebe zu Männern. Grautoff hat sich deswegen bereits bei einem Berliner Sexualwissenschaftler in Behandlung begeben.
In den ersten Wochen dieses Jahres muss Otto Grautoff einen Brief nach Rom geschickt haben, in dem er Thomas berichtet, dass er dem Arzt einige Papiere mit persönlichen Aufzeichnungen übergeben hat. Thomas gerät in Angst:
Was mich persönlich von allem am meisten beunruhigt, ist der Umstand, daß Deine Manuskripte […] noch immer nicht wieder in Deinen Händen sind […] Die Sache ist mir umso unheimlicher, als der Verdacht nahe liegt, daß Du auch mich in den Schriften gelegentlich kompromittiert, meinen Namen, Äußerungen von mir erwähnt hast […].1
Er bittet um «volle Aufklärung», und als die nicht prompt erfolgt, fragt er ein weiteres Mal: «Ist in den bewußten Manuskripten mein Name enthalten?» Grautoff scheint dem Freund schließlich versichert zu haben, dass sich in seinen Aufzeichnungen nichts Verfängliches findet. Doch Thomas’ Angst hält wohl noch eine ganze Weile an – und das zu Recht.2 [2]
Denn auch wenn in Italien Homosexualität nicht geahndet wird – im Deutschen Kaiserreich ist Sex zwischen Männern eine Straftat. Das legt der Paragraph 175 fest, der zur Zeit von Thomas’ Aufenthalt in Rom seit einem Vierteljahrhundert in Kraft ist. Dieser Paragraph zwingt gleichgeschlechtlich liebende Männer, ihre Neigung zu verstecken. Er setzt sie der Willkür von Erpressern und Vermietern aus, zerstört Glück und Ansehen zahlreicher Menschen – und treibt viele in den Suizid.
Der Paragraph 175: Wie ein deutsches Gesetz queeres Leben kriminalisierte
Entstanden ist der Paragraph 175 in den 1860er-Jahren. Damals beraten Anwälte, Richter und Professoren über ein einheitliches Strafgesetzbuch für den deutschen Nationalstaat, dessen Gründung sie bald erwarten. Dabei sprechen sie auch über die «Sodomiegesetze», die sowohl Sex zwischen Männern und als auch Sex mit Tieren unter Strafe stellen (beide Handlungen auf eine Stufe zu stellen, ist als bewusste Demütigung zu verstehen). Diese Gesetze gelten in mehreren deutschen Ländern, etwa in Preußen und Sachsen. Andere Territorien Deutschlands haben sie schon lange abgeschafft, das Königreich Bayern bereits 1813.
Als sich am 29. August 1867 in München der Deutsche Juristentag trifft, findet sich unter den 500 Rechtsgelehrten auch Karl Heinrich Ulrichs. Einst war er Gerichtsassessor im Königreich Hannover, musste aber auf sein Amt verzichten, weil er «widernatürliche Unzucht» mit anderen Männern trieb. In München tritt er nun als erster Schwulen-Aktivist der Weltgeschichte auf. Seine Mission: die Abschaffung der Sodomiegesetze in ganz Deutschland.
Am Rednerpult fordert er die Zuhörer auf, die «Verfolgung einer […] auch in Deutschland nach tausenden zählende Menschenclasse» zu beenden. Einer Gruppe, die «aus keinem andren Grund einer strafrechtlichen Verfolgung […] ausgesetzt ist, als weil die räthselhaft waltende […] Natur ihr eine Geschlechtsnatur eingepflanzt hat, welche der allgemeinen gewöhnlichen entgegengesetzt ist». Nicht alle im Saal begreifen sofort, um welche «Menschenclasse» es geht. Als sie es verstehen, bricht ein Tumult los. Ulrichs kann seine Rede nicht zu Ende bringen.3
Doch er hört nicht auf, sich für die Sache der Homosexuellen zu engagieren. Und klärt mit einer eigenen Schriftenreihe über die gleichgeschlechtliche Liebe auf – die Blätter gehen per Post an Abonnenten in Deutschland und England, nach Russland und in die USA.
Ein wichtiger Unterstützer der gleichgeschlechtlich Liebenden ist der Berliner Arzt Rudolf Virchow, einer der bekanntesten Mediziner Deutschlands. Er führt den Vorsitz über einen Ausschuss des Justizministeriums, der sich ebenfalls mit den Sodomiegesetzen befasst. Virchow und die anderen Ausschussmitglieder legen im März 1869 ein Gutachten vor, das sich für die Abschaffung der diskriminierenden Regeln ausspricht.
Doch etwa zur selben Zeit ereignen sich in Berlin mehrere grausame Sexualverbrechen an Jungen – als Täter werden Homosexuelle vermutet. Die Stimmung auf den Straßen und in den Behörden kippt. Als das Kaiserreich 1871 gegründet wird, zieht der Paragraph mit der Nummer 175 ins deutsche Strafgesetzbuch ein und stellt «widernatürliche Unzucht […] zwischen Personen männlichen Geschlechts» unter Strafe. Der Paragraph gilt nun überall im Reich – auch dort, wo die Sodomiegesetze schon längst abgeschafft sind.

Widerstand gegen Paragraph 175 – Magnus Hirschfeld und Thomas Mann
Dreißig Jahre nach Ulrichs’ mutiger Rede auf dem Juristentag führt der Berliner Sexualforscher Magnus Hirschfeld das Erbe dieses Pioniers weiter – und gründet mit einigen Männern das «Wissenschaftlich-humanitäre Komitee». Es ist die weltweit erste Organisation, die für gleichgeschlechtliche Rechte kämpft. Ihr wichtigstes Ziel ist die Streichung des Paragraphen 175. Hirschfeld und seine Mitstreiter setzen eine Petition an den Reichstag auf, unterstützt vom SPD-Chef August Bebel, den Hirschfeld vom Studium kennt. Bald haben mehr als tausend Menschen die Bittschrift unterzeichnet. Doch sie wird im Reichstag nicht angenommen, der Paragraph 175 bleibt in Kraft.
Thomas Mann mag den Kreis um Magnus Hirschfeld nicht. Denn während Manns Idealbild der hübsche Jüngling ist, ist Hirschfeld fasziniert von der ungeheuren Vielfalt der Geschlechter. Er entdeckt jenseits des binären Mann-Frau-Schemas Trans*personen, Intersexuelle, Transvestiten und Damendarsteller – insgesamt 43 Millionen geschlechtliche Varianten. Für Thomas Mann jedoch besteht Hirschfelds Gruppe aus «dummen Herdentieren», die «in der Fistel reden und sich mit weiblichen Namen nennen».4
Kurz vor 1900 verliebt sich Thomas heftig in einen fast gleichaltrigen Mann, der seinem Ideal nahekommt: der Tiermaler Paul Ehrenberg – blond, blauäugig, volle Lippen. Vier Jahre dauert ihre oft turbulente Freundschaft an. Paul, der in den Münchner Salons als Frauenschwarm bekannt ist, gibt ihrem Beisammensein gewissermaßen eine heterosexuelle Fassade, schützt den Freund vor Nachstellungen und Gerüchten.
Wie schnell – und mit welcher Gehässigkeit – Menschen zu Opfern des Paragraphen 175 werden, zeigt eine Pressekampagne, die der Journalist Maximilian Harden im November 1906 lostritt: Er deutet an, dass zwei enge Vertraute des Kaisers – Philipp Fürst zu Eulenburg und Kuno von Moltke – homosexuelle Beziehungen führen. Fast drei Jahre lang ziehen sich die Prozesse um die beiden Adeligen, Zeitungen berichten ausführlich. Zwar werden weder Eulenburg noch Moltke schuldig gesprochen; doch ihre Reputation ist ruiniert. Im gesamten Reich steigt rasant die Zahl der Schwulen, die aus Angst vor Bloßstellung und Verfolgung Selbstmord begehen.
In der Republik von Weimar, oft hymnisch beschrieben als eine Zeit der Exzesse und der Lebenslust, können gleichgeschlechtlich liebende Menschen etwas leichter leben, zumindest in den Großstädten. Doch Parteien wie das katholische Zentrum und die Deutschnationale Volkspartei machen gegen eine Emanzipation der Homosexuellen mobil. 1925 fordern sie gar eine Verschärfung des Paragraphen, um den vermeintlichen Absturz in Degeneration und Sittenverfall zu verhindern.
Dagegen wendet sich vier Jahre später der Strafrechtsausschuss des Reichstags: Er empfiehlt, Sex zwischen erwachsenen Männern nicht länger zu ahnden. Für kurze Zeit scheint endlich eine Entschärfung des Paragraphen in Sicht! Doch dann spülen die Reichstagswahlen 1930 eine große Zahl von NSDAP-Anhängern ins Parlament, für den Vorstoß des Ausschusses gibt es keine Mehrheit mehr.
Thomas Mann hat sich in den Weimarer Jahren gewandelt. 1922 hält er in Berlin die Rede «Von deutscher Republik» und entwickelt darin auch die Utopie eines homoerotisch-männerbündischen Staates. Er unterzeichnet die Petition zur Abschaffung des Paragraphen, die Magnus Hirschfeld vor einem Vierteljahrhundert gestartet hatte. 1930 veröffentlicht er in der Homosexuellen-Zeitschrift «Der Eigene» den Beitrag «Der Paragraph muss fallen». Und fragt sich, wie
eine solche Plumpheit von Gesetzesbestimmung wie der §175 […] noch für möglich gehalten werden kann.5
Paragraph 175 in NS-Zeit und Bundesrepublik – Von der Verschärfung bis zur Abschaffung 1994
Die Petition zur Abschaffung des Paragraphen 175 blieb ohne Wirkung. Drei Jahre später übernimmt das NS-Regime die Macht – und baut das Gesetz zum Instrument systematischer Verfolgung aus. Nachdem Hitler mit dem homosexuellen SA-Führer Ernst Röhm seinen langjährigen Weggefährten hat ermorden lassen, verschärft das Regime den Paragraphen drastisch: Galten bislang nur «beischlafähnliche Handlungen» als strafbar (gemeint sind Anal-, Schenkel- und Oralverkehr), sind nun auch ein inniger Kuss, gemeinsames Onanieren und selbst das Aneinanderschmiegen zweier nackter Körper schwere Vergehen. Mehr als 50 000 Männer lässt das Regime in den zwölf Jahren seiner Herrschaft verurteilen, steckt sie in Zuchthäuser und Konzentrationslager, wo viele ermordet werden oder an den fürchterlichen Haftbedingungen sterben.
Die nationalsozialistisch verschärfte Fassung des Paragraphen 175 überlebt das Kriegsende und gilt nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland zwanzig Jahre ohne jede Änderung weiter. Zwei Männer, die nach Paragraph 175 verurteilt wurden, wenden sich an das Bundesverfassungsgericht und verweisen auf die faschistische Prägung des Paragraphen. 1957 weisen Deutschlands höchste Richter die Klage nach längeren Beratungen ab und erklären, dass der Paragraph die «gesunde und natürliche Lebensordnung im Volk» schütze. Allein von 1950 bis 1965 verurteilen Richter rund 45 000 Männer.
Mit den Frankfurter Auschwitzprozessen beginnt in den 1960er-Jahren die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Der Einfluss der christlichen Kirchen schwindet, und aus den USA schwappen die Protestwellen gegen den Vietnamkrieg nach Europa. In dieser neuen, freieren Zeit beschließt 1969 die erste Große Koalition der Bundesrepublik: Gleichgeschlechtlicher Sex von über 21-Jährigen wird nicht mehr als Straftat verfolgt. Vier Jahre später senkt der Bundestag das Schutzalter für gleichgeschlechtlich Liebende auf 18 Jahre (für heterosexuelle Jugendliche liegt es zu dieser Zeit bei 14 Jahren).
In der Bundesrepublik wird der Paragraph 175 erst 1994 vollständig abgeschafft (die DDR hatte ihren Homosexuellen-Paragraphen bereits 1988 gestrichen). Endlich werden nun in ganz Deutschland Homo- und Heterosexuelle rechtlich gleich behandelt.
Doch die Geschichte ist keine kontinuierliche Fortschrittserzählung. In den Wochen, in denen dieser Artikel entstanden ist, kündigt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán an, die «Budapest Pride» zu verbieten. In den USA setzt die Trump-Regierung eine Hatz gegen Trans*personen in Gang, und in Deutschland werden Regenbogenfahnen zerschnitten, queere Bars mit homophoben Parolen beschmiert.
Der Kampf für gleiche Rechte hört nicht auf.
Literaturangaben
- Thomas Mann: Essays 3. Ein Appell an die Vernunft 1926–1933, hrsg. von Hermann Kurzke und Stephan Stachorski, S. Fischer 1994
- Thomas Mann: Briefe an Otto Grautoff und Ida Boy-Ed, hrsg. von Peter de Mendelssohn, S. Fischer 1975
- Karl Heinrich Ulrichs: «Gladius Furens». Das Naturräthsel der Urningsliebe und der Irrthum als Gesetzgeber. Eine Provocation an den deutschen Juristentag, Kassel 1868. Online abrufbar unter www.projekt-gutenberg.org/ulrichs/mannmae2/chap002.html
Zum Weiterlesen:
- Robert Beachy: Das andere Berlin. Die Erfindung der Homosexualität, Siedler Verlag 2015 -> Die aktuell beste Darstellung der Geschichte der Schwulen vom Kaiserreich bis in die Weimarer Republik
- Bruno Gammerl: Queer. Eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute, Hanser Verlag 2023 -> Beschreibt passend zum Buchtitel eine Vielzahl von Sexualitäten und bezieht dabei auch lesbische Frauen, Trans*personen und nicht binäre Gruppen ein
- Günter Grau: Homosexualität in der NS-Zeit. Dokumente einer Diskriminierung und Verfolgung, S. Fischer 2004 -> Zeigt anhand zahlreicher Schriftstücke die systematischen Entrechtung von homosexuellen Männern und Frauen durch das NS-Regime
Empfohlene MON_Mag-Artikel zu Queerness:
- Lisa Jeschke: «Lasst uns über Gender reden! – Über Erika Manns anti-patriarchales Auftreten und Therese Giehses idealisierte Weiblichkeit» – (18.11.2020)
- Theresa Seraphin: «Lücken im Gedächtnis: Homosexualität in der Weimarer Republik» – (17.11.2020)
- «GAY AGAIN – Theresa Seraphin und Lisa Jeschke im Interview» – (20.06.2020)

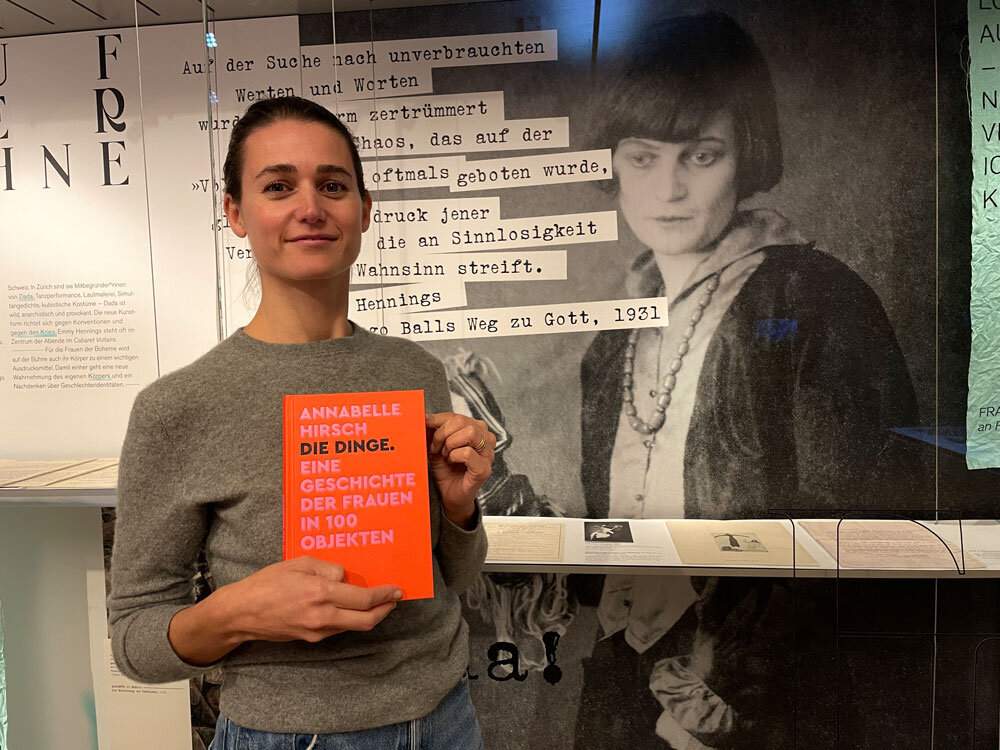

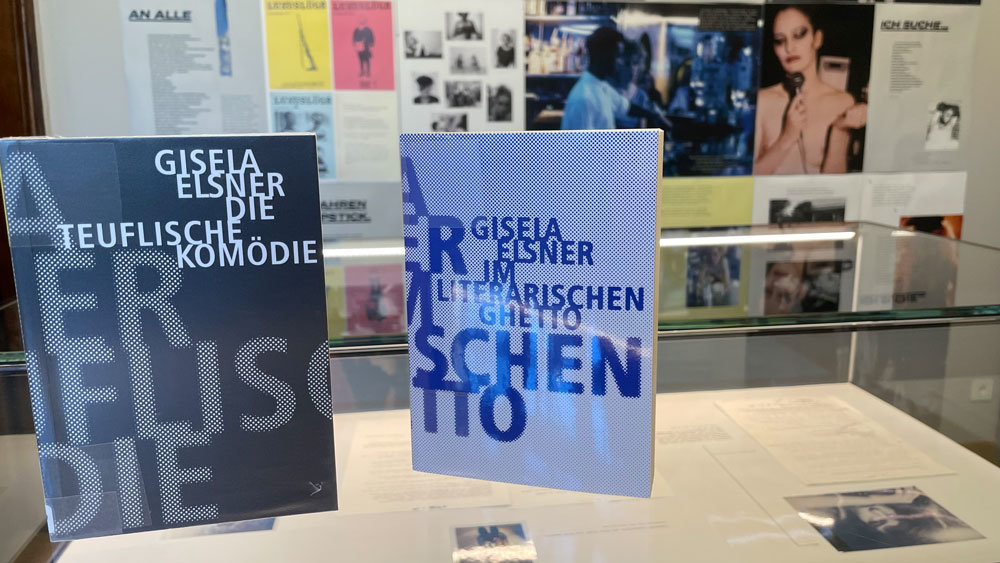
4 Antworten