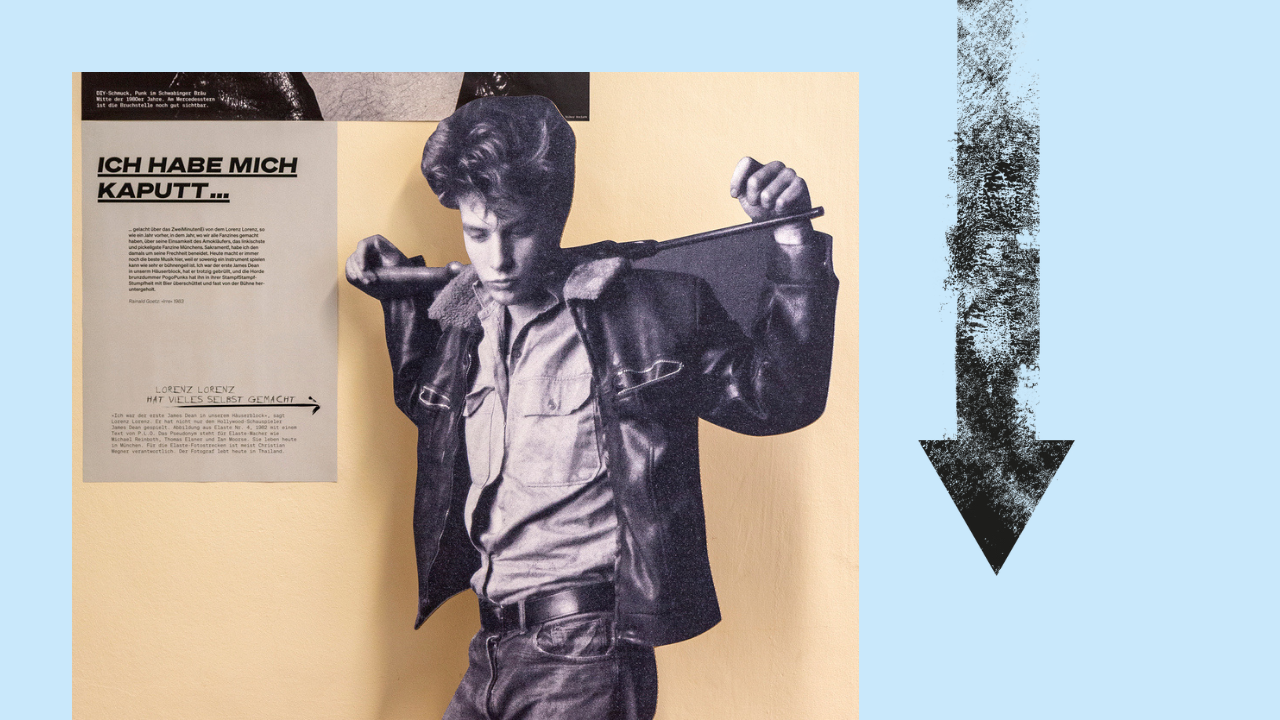Die Ausstellung im Lenbachhaus «Aber hier leben? Nein danke. Surrealismus + Antifaschismus» im Kunstbau steht im Mittelpunkt des fünften #GLAMInstaWalk|s* der Münchner Kulturhäuser. Der Surrealismus war mehr als Kunst – er war ein Aufruf zur radikalen Veränderung der Gesellschaft. Entdeckt vom 3. Februar ab 12 Uhr bis zum 2. März auf Instagram fesselnde Geschichten des Surrealismus und seiner Vertreter*innen.
Folgt auf Instagram den Hashtags #GLAMInstaWalk und #AberHierLebenNeinDanke und seid gespannt, welche Bezüge die 17 GLAM-Häuser auf ihren Instagram-Kanälen zu ihren eigenen Sammlungen für die Ausstellung im Lenbachhaus herstellen – ein Perspektivwechsel der etwas anderen Art.

Der #GLAMInstaWalk zur Ausstellung «Aber hier leben? Nein danke. Surrealismus + Antifaschismus» – Lenbachhaus
Der Surrealismus war eine internationale Bewegung, deren Ideen von Paris bis Mexiko, von Prag bis Chicago reichten. Seine Vertreter*innen prangerten Kolonialismus, Faschismus, Nationalismus und Kapitalismus an, schrieben Poesie, schufen Kunst und kämpften weltweit für Freiheit.
Während des Rundgangs durch die Ausstellung „Aber hier leben? Nein danke. Surrealismus + Antifaschismus“ blicken wir auf folgende Fragen/Gesichtspunkte:
1. Der Beginn des Surrealismus als internationalistische Bewegung
Der Surrealismus war eine politisierte Bewegung von internationaler Reichweite und internationalistischer Überzeugung. Seine Anfänge liegen in der Kunst und der Literatur, er reichte jedoch weit über beide hinaus. Die Wirklichkeit war für die Surrealist*innen ungenügend: Sie wollten die Gesellschaft radikal verändern und das Leben neu denken. Die Regierung und Besatzung durch faschistische Parteien in mehreren Ländern Europas wie auch die Welt- und Kolonialkriege prägten den Surrealismus und zwangen die Leben seiner Protagonist*innen in unvorhersehbare Bahnen. Zugleich ergaben sich erstaunliche Begegnungen, deren Verbindungslinien von Prag nach Coyoacán in Mexiko-Stadt, von Kairo ins republikanische Spanien, von Marseille nach Fort-de-France auf Martinique, von Puerto Rico und Paris nach Chicago und zurück reichten.
Zu Beginn der Ausstellung begegnen uns zwei Zentren des Surrealismus: Paris und Prag. Im Paris der 1920er Jahre bildete sich die erste surrealistische Gruppe um den Dichter André Breton. Die Sinnlosigkeit und Brutalität des Ersten Kriegs ließen sie an der Logik der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zweifeln. Die surrealistische Gruppe in Prag setze sich aus Autor*innen und Künstler*innen auch Schauspieler*innen, Gestalter*innen, Architekt*innen und Fotograf*innen zusammen. Ihre Mitglieder organisierten sich in kommunistischen und anarchistischen Bewegungen, sie publizierten Bild- und Gedichtbände zur Unterstützung der Spanischen Republik und diskutierten das Verhältnis künstlerischer Arbeit zum Marxismus.

2. Leerstelle Deutschland
Die Nationalsozialisten übernahmen am 30. Januar 1933 die Macht, Hitler wurde Reichskanzler und die NSDAP die einzige in Deutschland zugelassene Partei. Die
nationalsozialistische Diktatur war für viele Menschen existenz- und lebensbedrohend. Die Kunstpolitik des „Dritten Reichs“ vollzog eine radikale Abkehr von der Moderne und führte sie als Degenerationserscheinung vor.
Mit dem Fokus der Ausstellung auf den politischen Surrealismus stellt sich die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen von surrealistischer Kunst in Deutschland. Wegen der (kunst)-politischen Situation mussten die meisten dezidiert antifaschistisch orientierten Surrealist*innen das Land verlassen. Deshalb zeigt die Ausstellung eine surrealistische Leerstelle im nationalsozialistischen Deutschland. Eine offene und konsequente Fortführung surrealistischer Praktiken war fast nur im Exil möglich, und auch hier oft unter erschwerten Bedingungen. Zu den Künstler*innen, die zeitweise in Frankreich lebten, gehörten Max Ernst, Wols, Hans Bellmer, Heinz Lohmar, Wolfgang Paalen, John Heartfield, Erwin Blumenfeld und Kati Horna.

3. Widerstand, Flucht und Exil
Während der Besetzung Frankreichs ab 1940 bildete sich eine neue surrealistische Gruppe, „La Main à plume“. Anders als viele ältere Surrealist*innen blieben die Mitglieder in Frankreich und bekämpften den Faschismus vor Ort. Ihr Vorgehen verpflichtete sie zu einem Leben im Untergrund: Sie versteckten sich gegenseitig in Privatwohnungen in Paris und im Süden, fälschten Papiere und verdienten Geld mit Gemäldekopien. Viele ließen im antifaschistischen Kampf ihr Leben, andere wurden deportiert und in Konzentrationslagern ermordet.
Andere Künstler*innen flohen aus Deutschland nach Frankreich und wurden dort nach dem Einmarsch der Deutschen als feindliche Ausländer*innen interniert. Weitere hofften auf eine Flucht aus Europa und warteten in Marseille darauf, alle Papiere für eine Überfahrt nach Martinique zusammenzubekommen. 1941 brachte die Flucht auf einem Schiff viele der surrealistischen Künstler*innen zusammen: Wir begegnen dort
- dem Künstler Wifredo Lam,
- der Autorin Anna Seghers,
- André Breton,
- dem linken Revolutionär und Schriftsteller Victor Serge,
- der Fotografin Germaine Krull, die die Überfahrt fotografisch festhielt,
- und hunderte weitere Menschen.
Martinique war oft eine Zwischenstation, von wo aus die Personen in andere Länder flohen. Für André Breton, Jacqueline Lamba und André Masson verlief der Weg von Martinique nach New York; der in Frankreich lebende Kubaner Wifredo Lam flüchtete über Martinique zurück nach Kuba und ließ sich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Europa nieder. Das Leben des Musikers und Malers Eugenio Granell war eine Odyssee: Als Spanier und republikanischer Kämpfer im Bürgerkrieg ging er nach der Niederlage nach Paris, dann via Marseille nach Santo Domingo, Guatemala und Puerto Rico, schließlich nach New York, bevor er 1985 nach Spanien zurückkehrte.
Weitere Informationen unter www.lenbachhaus.de

Beteiligt euch und macht mit!
Stellt eure Fragen an die teilnehmenden Museen, Archiven, Galerien oder Bibliotheken. Kommentiert die Beiträge und teilt, was euch interessiert. Worüber wollt ihr mehr erfahren?
Schaut bis zum 2. März regelmäßig auf Instagram vorbei – unter dem Hashtag #GLAMInstaWalk passiert viel Spannendes! Alle Beiträge dokumentieren wir zudem auf einer Wakelet Collection #AberHierLebenNeinDanke für einen besseren Überblick.
*Was ist ein #GLAMInstaWalk?
GLAM steht für Galleries, Libraries, Archives and Museums. Der #GLAMInstaWalk ist eine Kooperation der Münchner Kulturhäuser und Gedenkstätten auf Initiative der Monacensia: Aktuelle Ausstellungen und Projekte werden gemeinsam vor Ort erkundet und zeitgleich auf den Instagram-Kanälen dem eigenen Publikum präsentiert. Entdeckt die Vielfalt der Erinnerungskultur und eure Gemeinsamkeiten!
*Alle Fakten zum #GLAMInstaWalk
Datum: 3. Februar, Start um 12 Uhr für eine Stunde
Hashtag: #GLAMInstaWalk # AberHierLebenNeinDanke #Erinnerungskultur
Führung durch die Ausstellung „Aber hier leben? Nein danke. Surrealismus + Antifaschismus“, Lenbachhaus
Postings der Teilnehmenden: 3.2. – 2.3. auf den Instagram-Kanälen der GLAM-Häuser
Teilnehmende GLAM-Institutionen:
Lenbachhaus – @Lenbachhaus
Monacensia im Hildebrandhaus – @monacensia_muc
NS-Dokumentationszentrum – @nsdoku
Villa Stuck – @villastuck
Valentin Karlstadt Museum – @valentin.karlstadt.musaeu
Jüdisches Museum München – @juedischesmuseum
Museum Ägyptischer Kunst München – @aegyptisches_museum_muenchen
Münchner Stadtmuseum – @muenchnerstadtmuseum
Denkmäler_Bayern – @denkmaelerbayern
Infopoint Museen und Schlösser – @museeninbayern
Bavarikon4U auf TikTok
Institut für Zeitgeschichte
Blog: Archive in München / @amucblog
Stadtarchiv München – @stadtarchivmuenchen
LMU-Bibliothek – @ub_lmu
Münchner Kammerspiele – @muenchner_kammerspiele
Rathausgalerie – @rathausgalerie.muenchen

>>>AKTUELL – Beiträge zum #GLAMInstaWalk<<<
Hier erscheinen die Beiträge zum 5. Walk der Münchner Kulturhäuser. Beiträge im Netz werden auch auf der Wakelet-Collection «Aber hier leben? Nein Danke. Surrealismus + Antifaschismus» dokumentiert.
Blog-Artikel zur Aktion:
- Blog Museen in Bayern: «Für die Demokratie? Ja zusammen.» – (19.02.2025)
- Archive in München, Ute Elbracht: «HEIDUK – ein Gespenst geht um in München» – (6.2.2025)
- Archive in München, Ute Elbracht: «Frühe Re-Education im Nachkriegsdeutschland: Nationalsozialismus und Kunst / Marburger Vorträge» – (6.2.2025)
Folgende #GLAMInstaWalk|s fanden bereits statt:
- «Lenbachhaus: «Surrealismus + Antifaschismus – #GLAMInstaWalk in der Ausstellung im Kunstbau (5)» (3.1.–2.3.2025)
- «Jugendstil in München – #GLAMInstaWalk in der Kunsthalle München und im Deutschen Theatermuseum (4)» (7.11.-5.12.2024)
- «#GLAMInstaWalk der Villa Stuck: „Was bisher geschah.“ Goethestr. 54 in München (3)»
- «Operation Finale. How To Catch A Nazi“ – Adolf Eichmann im Museum Ägyptischer Kunst (2)» (5.–31.3.2024) – dokumentiert in der Wakelet Collection #HowToCatchANazi
- «NS-Dokuzentrum: Sammeln als Akt des Widerstandes – Das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos» (18.–23.10.2023) – dokumentiert in der Wakelet Collection #RingelblumArchiv
Auch Kulturhäuser, die aus der Ferne teilnehmen möchten, können sich unter dem Hashtag #GLAMInstaWalk beteiligen und sich darüber untereinander vernetzen. Die Aktion ist ein neues Vermittlungsformat, um gemeinsam hinter die Kulissen der Erinnerungskultur zu blicken. Eure Fragen beantwortet euch Tanja Praske von der Monacensia: tanja.praske@muenchen.de.