Als Stummfilmproduzent und Mitbegründer der Emelka-Filmstudios zählt der jüdische Unternehmer Karl Wiesel zu den Pionieren des deutschen Films. In der NS-Zeit ins Exil getrieben, starb Wiesel 1941 auf der Flucht nach Havanna. Eine nahezu vergessene Biografie aus der Frühzeit des deutschen Kinos – porträtiert von Hermann Wilhelm für die Dauerausstellung «Maria Theresia 23».
Karl Wiesel – Vom Bekleidungsgewerbe zur Filmproduktion
Am 16. November 1912 eröffnen zwei bisher im Bekleidungsgewerbe tätige Geschäftsleute im ehemaligen «Konfektionshaus Fett» am Max-Weber-Platz 11 ihr erstes Kino. Damit gehören Karl Wiesel und Isidor Fett zu den ersten Kinobesitzern im Münchner Osten – neben Maria Zach, die schon ab 1909 das «Kinematograph-Thalia-Theater» an der Ecke Rosenheimer/Metzstraße und ab 1912 die «Ostbahnhof Lichtspiele» (OLi) am Orleansplatz betreibt. Alsbald machen die beiden jüdischen Unternehmer eine fantastische Karriere. Dennoch bleiben sie in Publikationen zur Münchner Filmgeschichte oftmals unerwähnt.
Da ist zum einen der in Dębica in Galizien – damals Österreich-Ungarn – geborene Isidor Isaak Joseph Fett. Er betreibt vor der Eröffnung der «Lichtspiele am Max-Weber-Platz» in den dortigen Räumlichkeiten ein «Geschäft für Herren- und Knabengarderobe». Zum anderen ist da Karl Wiesel, geboren am 4. November 1881 in Żurawno und damit ebenfalls in Galizien. Nach einer Kindheit in Wien – die Eltern waren 1883 in die österreichische Hauptstadt gezogen – siedelt die Familie 1893 oder 1894 nach München über. Im Dezember 1905 heiratet Karl Wiesel die aus Würzburg stammende Ernestine Kiesel. Er betreibt zu jener Zeit in der Dultstraße 2a in der Nähe des Jakobsplatzes die «Partiewaren-Halle Karl Wiesel», in der Restposten und sonstige Waren zu reduzierten Preisen angeboten werden.
Während des Ersten Weltkriegs ist der inzwischen zum Kinofachmann gereifte Wiesel Mitarbeiter der Filmstelle des österreichischen «Kriegspressequartiers». Es hat seinen Sitz im diesbezüglichen Konsulat in München. Er wird für «Verdienste in der Heimat» und «freiwillige Tätigkeit zum Wohl des Landes und der Armee» mit dem 1916 von König Ludwig III. gestifteten König-Ludwig-Kreuz ausgezeichnet. Nach Kriegsende, Revolution und Gründung des Freistaats Bayern 1918/19 wird Wiesel kurzzeitig Mitglied der Münchner Einwohnerwehr.

«Bayerische Filmgesellschaft Fett & Wiesel»: Der Aufstieg in der Filmindustrie
Gleichzeitig macht sich Karl Wiesel in der von der Münchner Kunst- und Kulturszene eher herablassend beäugten Kinobranche schnell einen guten Namen. Schon 1913 gründet er zusammen mit seinem Partner Isidor Fett neben der «Bayerischen Filmvertriebsgesellschaft» und der Verleih-Firma «Quo Vadis-Film» die «Bayerische Film-Gesellschaft Fett & Wiesel». Spätestens seit dem Sensationserfolg des 1916 in die Kinos kommenden Science-Fiction-Stummfilms «Die große Wette» – mit Harry Piel als Darsteller und Regisseur – gehört Wiesel als Produzent zu den erfolgreichsten Akteuren der Münchner Filmszene.
Die «Bayerische Film-Gesellschaft» unterhält alsbald Filialen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Danzig sowie Niederlassungen in Zürich, Wien, Prag und Amsterdam. Damit zählt sie zu den einflussreichsten Produktions- und Vertriebsfirmen in Deutschland. Zwischen 1915 und 1931 produziert Karl Wiesel über 50 Stummfilme. Beschrieben als «elegant und kultiviert», ist er inzwischen zusätzlich als Geschäftsführer der «Harry Piel Film Company mbH» sowie der «Weltfilm Gesellschaft» tätig.

Direktor bei der Emelka: Gegen die Ufa-Macht aus Berlin
1920 schließen sich sieben der bekanntesten Münchner Filmunternehmen zur legendären «Emelka» («Münchner Lichtspielkunst AG») zusammen. Ihr gemeinsames Ziel ist, gegen den Einfluss und die Marktmacht der in Berlin ansässigen und während des Ersten Weltkriegs von führenden Militärs und der Deutschen Bank gegründeten «Ufa» bestehen zu können. Karl Wiesel und Isidor Fett avancieren zu Direktoren, «die als Filmgroßkaufleute in der ganzen Filmbranche jedem bekannt sind». So gehört Karl Wiesel als Gründungsmitglied der «Emelka» zu den Vätern der «Filmstudios Geiselgasteig» und der sich später daraus entwickelnden «Bavaria Filmstadt».
1921 erwirbt Karl Wiesel die auch heute noch mit illusionistischer Trompe-l’Œil-Malerei versehene Villa des Verlegers und Fotografen Max Hirmer in der Bogenhauser Möhlstraße 9. Zusätzlich unterstützt er die jüdische Gemeinde in München beim Kauf eines Grundstücks in der Münchner Reichenbachstraße. Wiesel gilt deshalb auch als Förderer und Mitbegründer der dort 1931 errichteten Synagoge.
Karl Wiesels Flucht vor den Nationalsozialisten
Mit der Machtübernahme 1933 verschlechtern sich die Arbeits- und Existenzbedingungen jüdischer Künstler*innen und Unternehmer*innen binnen kürzester Zeit. Auch Karl Wiesel (sein Geschäftspartner Isidor Fett verstirbt überraschend 1933) ist in zunehmendem Maße den Schikanen des NS-Regimes und dessen Vertreter*innen in der Filmbranche ausgesetzt. Am 19. April 1938 verlässt Wiesel Deutschland und flieht mit seiner Familie in die Schweiz. Von dort aus bemüht er sich um Tickets für die Schiffsüberfahrt nach Havanna. Im August 1941 gehen auch die Wiesels zusammen mit über tausend weiteren jüdischen Flüchtlingen an Bord der völlig überfüllten «SS Navemar».
Am 12. September 1941 erreicht das «Höllenschiff» New York. Während der siebenwöchigen Überfahrt war an Bord aufgrund der unhygienischen Zustände Typhus ausgebrochen. Sechs Passagiere starben auf hoher See, sieben weitere nach der Ankunft in New York. Unter den Toten ist auch Karl Wiesel. Er erliegt der heimtückischen Krankheit noch während der Überfahrt am 25. August 1941. Drei Monate später, am 21. November 1941, erinnert ein Nachruf in der deutsch-jüdischen Zeitung «Aufbau» in New York an den Münchner Filmkaufmann:
Karl Wiesel tot. Karl Wiesel, einer der führenden Männer der deutschen und europäischen Filmbranche, ist, wie wir erst jetzt erfahren, auf dem Unglücksschiff ‹Navemar› am 25. August, kurz vor seinem 60. Geburtstag, in den Armen seiner Gattin gestorben.
Ein Jahr später wird die Bogenhauser Villa der Wiesels vom NS-Regime zwangsenteignet.
Die meisten unter der Produktionsleitung von Karl Wiesel und Isidor Fett gedrehten Stummfilme werden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bei Bombenangriffen vernichtet oder sind verschollen. Die Bogenhauser Villa der Wiesels in der Möhlstraße 9, nach 1945 in Besitz der Bundesrepublik Deutschland, wird 1953 an die Erben zurückgegeben.

Karl Wiesel: Stationen eines Münchner Kinopioniers
1881
Geboren in Żurawno (Galizien, damals Österreich-Ungarn)
1893/94
Übersiedlung der Familie nach München
1905
Heirat mit Ernestine Kiesel, Gründung eines Textilgeschäfts in München
1912
Eröffnung der Lichtspiele am Max-Weber-Platz mit Isidor Fett
1913–1916
Mitgründer mehrerer Filmfirmen, u. a. Bayerische Filmgesellschaft Fett & Wiesel
Produktion des Science-Fiction-Films «Die große Wette»
1915–1931
Über 50 Stummfilme produziert; Geschäftsführer mehrerer Filmfirmen (u. a. Harry Piel Film Company)
1920
Mitbegründer der Emelka (Münchner Lichtspielkunst AG) – als süddeutsches Gegengewicht zur Berliner Ufa
1921
Kauf der Villa Möhlstraße 9 in München-Bogenhausen
1933
Erste Repressionen nach NS-Machtübernahme; Tod von Geschäftspartner Isidor Fett
1938
Flucht in die Schweiz, später Versuch der Ausreise nach Havanna
25. August 1941
Tod auf der Flucht an Bord der SS Navemar, kurz vor der Ankunft in New York
Lesetipp zur Ausstellung «Maria Theresia 23»
- «Thomas Mann, der Lebensborn – und ich: Spurensuche zwischen zwei Münchner Villen in Bogenhausen» – Dirk Kaesler (28.05.2025)
Der Artikel von Hermann Wilhelm ist auch ein Beitrag zum 6. #GLAMInstaWalk in der Monacensia.
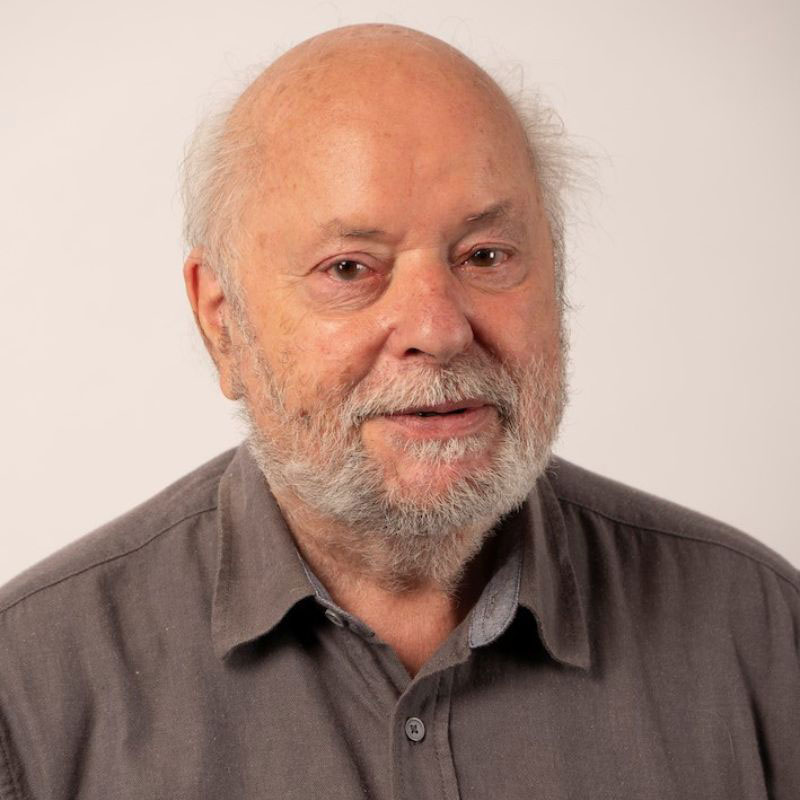


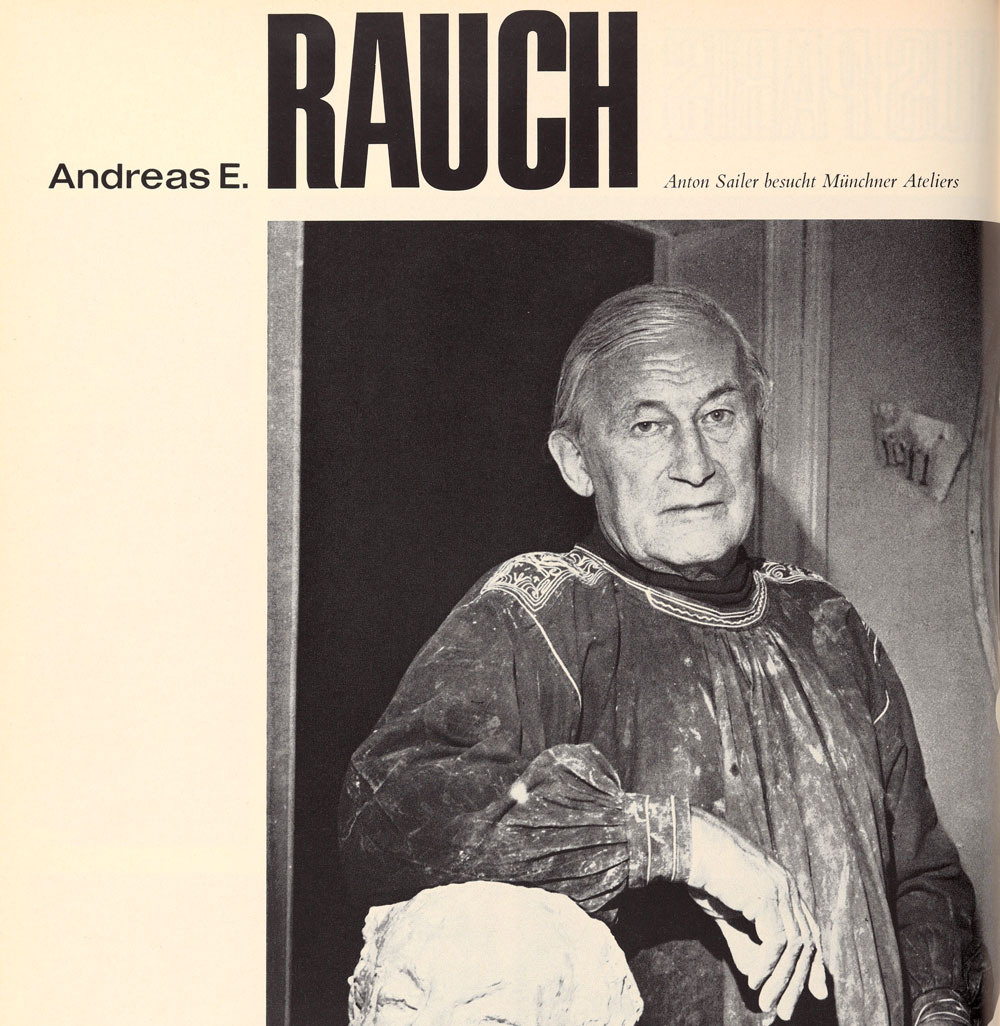
2 Antworten
Vielen Dank für diesen interessanten Beitrag zu Karl Wiesel und der Münchner Kinogeschichte! Es ist immer wieder spannend, welche Parallelen sich mit den anderen Münchner GLAM-Institutionen und insbesondere zwischen Monacensia und IfZ ergeben! So liegt beispielsweise der Nachlass eines anderen jüdischen Film-Unternehmers im IfZ-Archiv. Karl Wolffsohn betrieb Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre mehrere Kinos in Berlin, Essen und Düsseldorf und verlegte die international renommierte Filmzeitschrift „Lichtbildbühne“. Wie Wiesel musste auch Wolffsohn Deutschland Ende der 30er Jahre verlassen, mehrere seiner Unternehmen waren da bereits „arisiert“ worden. Wolffsohn überlebte in Palästina. Er kehrte nach Deutschland zurück und stritt viele Jahre um Wiedergutmachung. Nähere Infos gibt es hier: https://75jahre.ifz-muenchen.de/wissen/archiv/karl-wolffsohn-zwischen-arisierung-emigration-und-wiedergutmachung